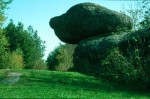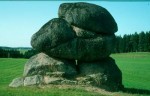Marmelade-Spezialitäten: Asperl und Hetscherl
19. November 2008 von Bernhard Baumgartner
- Vollreife Asperl
- Rohe und vorgekochte Asperl
- Gerät und Zutaten vorbereiten
- Beim Passieren – der schwerste Teil der Arbeit
- Zucker und Geliermittel
- Zucker einrühren
- Gestürzte Gläser
- Abgefüllte Marmelade und Fruchtbrei zum Einfrieren
- Fertig zum Einlagern
- “Hetscherlmarmelade”
- Von der “Hirschenwirtin”
Montag war “Asperltag”: Frei nach dem lustigen und etwa in “Heurigengesellschaft” gern gesungenen Lied – “Was ist heut für Tag? Heut ist Mittwoch – Strudeltag”…
Also nach Ernte vorige Woche und Vorbereitung der Früchte (die Stielreste unterseits und die Kelchreste oberseits wegschneiden – geht dann beim Passieren leichter) kam am Montag die Stunde der Flotten Lotte! So heißt das Gerät zum Passieren der vorgekochten Asperl (weil die Früchte so schön reif waren, genügte ein kurzes Aufkochen, und alles war schon schön breiig). Das Passieren ist die Hauptmühe und erfordert weniger Kraft (schon auch zum Festhalten des Geräts), als etwas Feingefühl – wenn die Passierscheibe stecken bleibt, leicht rückwärts und dann wieder vorwärts drehen. Nicht mit Gewalt, sonst springt die Flotte Lotte auseinander. Also liebe Leser und Asperlinteressenten, ihr erkennt schon daraus, hier spricht ein in mehreren Asperl-Einkochjahren bewährter Passierer, nicht namens Lotte, sondern BB. Übrigens wieviel Früchte verarbeitet wurden? So 7 bis 8 kg geputzt. Den etwas zu dicken Fruchtbrei mit etwas Wasser zu verdünnen, erleichtert die Arbeit (ca. 1/2 Liter insgesamt “zizerlweis” einrühren, wenns zu dick wird..), aber möglichst wenig verwässern.
Nächster Akt: Das eigentliche Einkochen. Der Fruchtbrei muss genau gewogen werden. Wir hatten 3,6 km Asperlbrei und gaben 35 dag Saft von Zitronen und Orangen dazu (erst jetzt, denn vorher hätten wir diesen Zitrussaft teilweise mit den übrig gebliebenen Kernen und Schalenresten weggeworfen). Noch ein Tipp – nicht zu viel in die Flotte Lotte einfüllen, 1 1/2 Suppenschöpfer genügen, sonst dreht sich der Passierer zu schwer, vor dem nächsten Nachfüllen die Kerne und Schalenreste herausputzen!
Unsere Zutaten sieht man bei den Bildern: Einkochmittel 1 zu 2, das heißt pro kg Fruchtmasse 1/2 kg Zucker und 1 Sackerl Geliermittel. Tipp – das Gelierpulver mit dem Zucker vor dem Einmischen in die Fruchtmasse extra in einem Gefäß verrühren, sonst können sich Bröckerl bilden, die nur mehr schwer zu zerrühren sind. Kochzeit gut 4 Minuten, dann heiß in die Gläser füllen (Gläser im Geschirrspüler gereinigt, vor dem Einkochen ganz heiß auswaschen und auf Geschirrtuch stürzen). Normalerweise gibt Anni (meine Arbeit ist jetzt schon zu Ende) noch ein in hochprozentigen Rum oder Schnaps getauchtes Blatt Zellophan auf das Glas und dreht erst dann den Deckel zu. Diesmal hatte wir keine solche “Einsiedehaut” (= Zellophan) mehr, war in den Geschäften schon ausverkauft oder weggeräumt, daher kamen die Deckel selbst in Schnapsbad. In der nächsten Saison mehr Zellophan auf Vorrat kaufen!!!
Was fehlt noch? Gläser abkühlen lassen, von den beim Einfüllen entstandenen Marmeladenpatzern reinigen und Etiketten draufkleben. Am besten ist das halb gefüllte letzte Glas, das nicht mehr voll geworden ist, denn da dürfen gleich alle naschen…
Noch eine Spezialität – haben wir vergangenen Samstag bei der freundlichen und tüchtigen “Hirschenwirtin” in Nölling / Gerolding / Dunkelsteinerwald kennengelernt: Marmelade aus “Hetscherl” – das sind die Rosenfrüchte, auch als “Hetschepetsch” bekannt – und als “Juckpulver”. Das vermerkt sogar die von mir schon mehrfach zitierte “Exkursionsflora”: Frucht der Rose ist die Hagebutte, eine Sammelfrucht, die kleine Samenkerne enthält, die sog. Früchtchen (als Kinder haben wir sie aufgebissen und jemand in den Halsausschnitt gesteckt – die feinen Härchen kitzeln fürchterlich) als Juckpulver verwendet: “Arschkitzel” (so original die botanische Bibel!). Im Prinzip wird Hetscherlmarmelade genauso hergestellt wie Asperlmarmelade – die Früchte vorkochen, dann passieren (die Kerne und Härchen verschwinden dabei – Scheibe mit der feinsten Lochung der Flotten Lotte verwenden, für die Asperl die mit den größten Löchern).
Nochwas hat die “Hirschenwirtin” gewusst: Die Asperl reifen nicht, wie von mir angenommen, durch das Gefrieren, sondern ganz einfach durch das Lagern. Sie reifen von innen heraus durch ein Ferment. Die Schlehen hingegen brauchen wirklich den Frost, damit das Reifungsferment frei gesetzt wird und sie weich werden. Ganz durchschau ich das nicht, aber wer´s genau wissen will, soll zur “Hirschenwirtin” nach Gerolding / Nölling fahren. Dort gibt es neben gutem Rat auch gute Sachen, jeden Samstag im November um 17 Uhr Wildbuffet (oder Bufett? merk ich mir einfach nicht). Bei den Nachspeisen hab ich mitgehört – Maronitorte…. Ach du “liebes” Cholesterin! Schon wieder zu hoch! Besser bei den Asperl bleiben und keine Butter auf Brot vor dem Aufstreichen der köstlichen Asperlmarmelade. Übrigens einen Tiegel Fruchtbrei haben wir eingefroren. Was daraus wird, wissen wir noch nicht – aber wenn es Elsbeerhonig und Hagebuttenhonig gibt, machen wir vielleicht einen “Asperlhonig”?